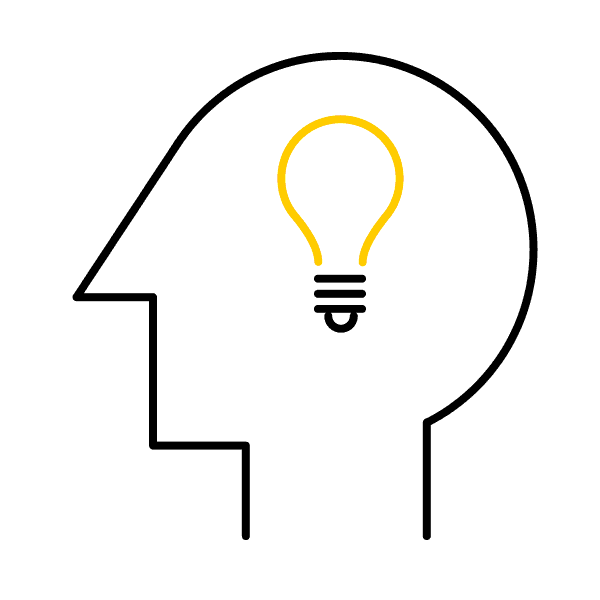Fällt im Alter das Erwerbseinkommen weg, sorgt die Altersvorsorge dafür, dass wir unser Leben finanziell unabhängig und ohne existenzielle Not weiterführen können. Am 1. Januar 1948 trat die AHV in Kraft und die ersten Renten wurden ausbezahlt. Heute geht der Anspruch an die Altersvorsorge über die reine Existenzsicherung hinaus. Ältere Menschen sollen ihre Zeit nach der Erwerbstätigkeit finanziell unabhängig gestalten und am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können. Das Schweizer Vorsorgesystem wurde deshalb im Laufe der Jahre ausgebaut und basiert heute auf drei Säulen: Die 1. Säule als staatliche Altersvorsorge, die 2. Säule als berufliche Vorsorge und die 3. Säule, die individuelle Vorsorge.