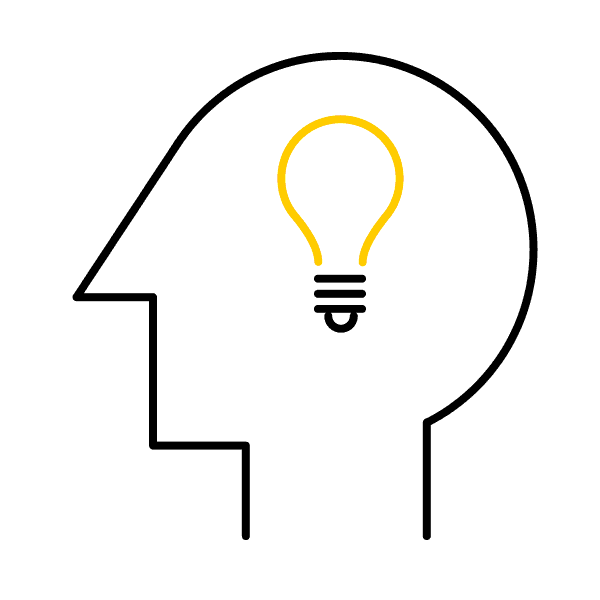Schuldzinsen sollen abgezogen werden können, wenn sie mit der Erzielung eines steuerbaren Ertrags im Zusammenhang stehen. Fällt der Eigenmietwert weg, ist es folgerichtig, den Schuldzinsenabzug einzuschränken.
Die Abzugsfähigkeit von Schuldzinsen auf Konsumkrediten ist bereits heute systemfremd, da der Kredit – wie schon der Name besagt – typischerweise der Finanzierung von Konsum dient und nicht der Erzielung eines Einkommens. Lombardkredite dienen oftmals der Finanzierung eines Wertschriftenportfolios. Aus diesem können steuerbare Vermögenserträge entstehen, ebenso jedoch auch Kapitalgewinne, die im Privatvermögen steuerfrei sind. Das Parlament hat sich für eine recht strenge Regel zur Begrenzung der Schuldzinsenabzugsfähigkeit entschieden.
Der heutige Schuldzinsenabzug ist als allgemeiner Abzug ausgestaltet. Schuldzinsen können mit der Reform nur noch für denjenigen Teil des Vermögens geltend gemacht werden, der auf vermietete und verpachtete Immobilien entfällt. Auch im Reformfall kommt es folglich nicht auf die Natur der Schuld (Hypothek, Lombard- oder Konsumkredit usw.) an. Eine Verknüpfung von Schulden zu einem Objekt liesse sich zwar formal-juristisch herstellen, ökonomisch ist eine solche Verknüpfung indessen kaum möglich.